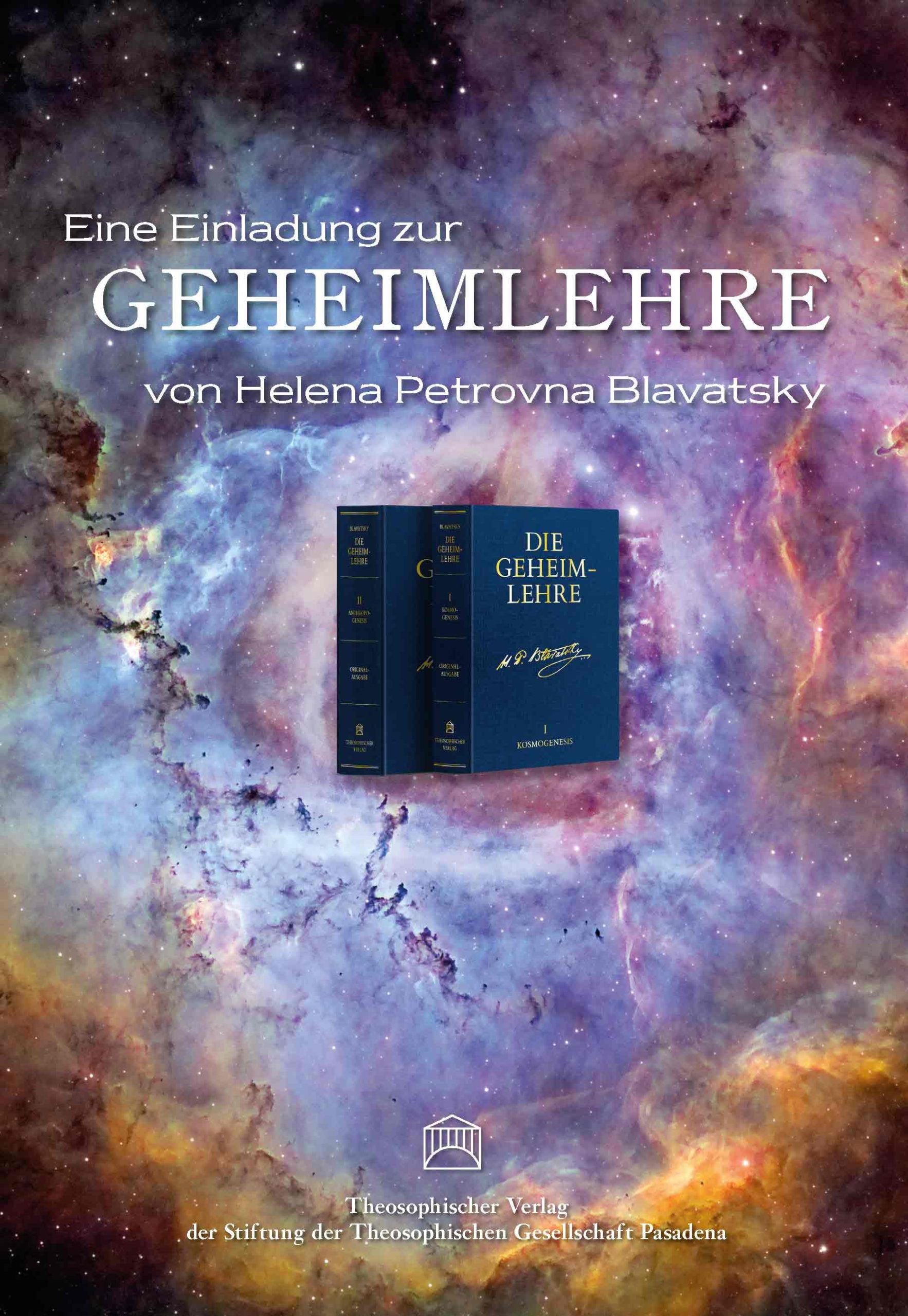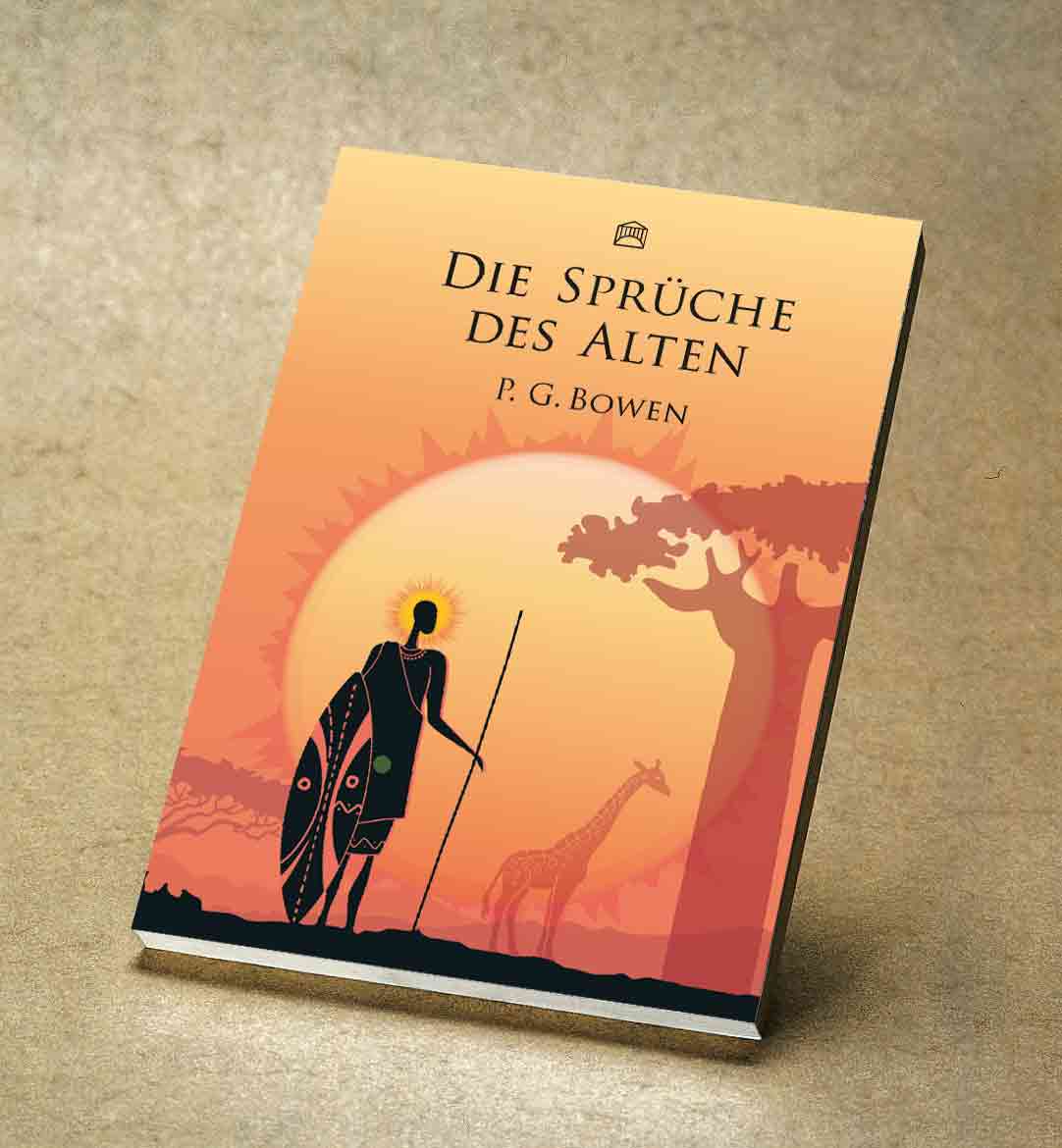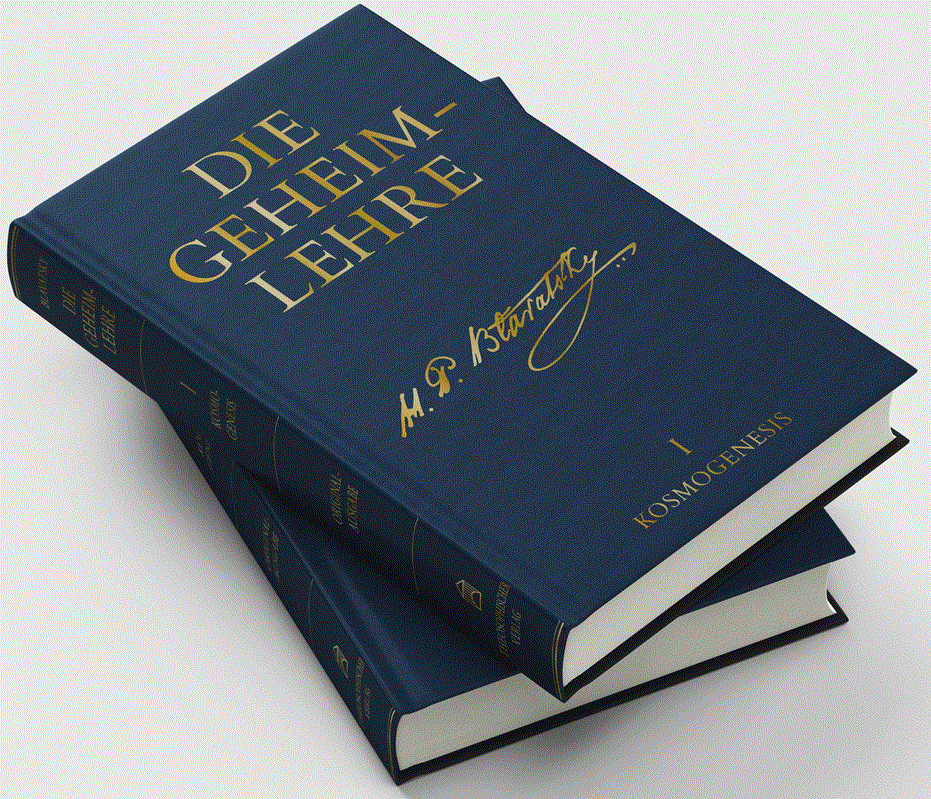Brahms – ‘Ein deutsches Requiem’
Wie kann ein monumentales Werk – ’Ein deutsches Requiem’ von Brahms – aus theosophischer Sicht interpretiert werden? Trotzdem der Text des Requiems ausschließlich aus Bibelzitaten besteht, hat er eine universale Perspektive. Brahms Ziel war es, ein universal gültiges Requiem zu komponieren.
2.269 Worte, Lesedauer 08:39 Minuten
Brahms: ‘Ein deutsches Requiem’
„Es ist ein ganz gewaltiges Stück, ergreift den ganzen Menschen in einer Weise, wie wenig anderes.“
– Clara Schumann an Johannes Brahms
Die Ergriffenheit Clara Schumanns, die sich in einem Brief an Johannes Brahms (1833-1897) zum Ausdruck brachte, entstand, als sie Weihnachten 1867 einen Klavierauszug des von Brahms komponierten Requiems in Händen hielt. Was hat Clara Schumann damals so tief berührt, was hält seit jener Zeit dieses Requiem so tief im Bewusstsein der Menschen unserer Kultur verwurzelt, den Musikern und Musik-Professoren, den Christen, aber auch den Liebhabern der klassischen Musik? Bis heute wird es oft zur Weihnachtszeit von den besten Chören und Orchestern der Welt aufgeführt. Vielfach studieren aber auch Laiengruppen mit großer Hingabe dieses Stück ein, oft von professionellen Musikern unterstützt. Es ist zweifellos die hohe und edle Schwingung und das Thema, welche dem Stück auf der Grundlage freien christlichen Denkens eine tief spirituelle Dimension verleihen.
Aus musikalischer Sicht markiert ‘Ein Deutsche Requiem’ einen Wendepunkt in der Kompositionstechnik, mit dem Brahms die gesamte Musikwelt nachhaltig beeinflusste. Dieser Aspekt soll hier allerdings nicht näher erläutert werden, obwohl die Art und Weise, wie Brahms die in der Endfassung des Werkes enthaltenen sieben Sätze anordnete und wie er einzelne Passagen komponierte seine freie und sowohl von kompositorischen als auch von christlichen Dogmen unabhängige Art des Denkens aufzeigt.
Am Karfreitag des Jahres 1868 wurde das Werk im Dom zu Bremen in seiner damals noch sechssätzigen Fassung uraufgeführt. Es erhielt schon zu dieser Zeit ein überwältigendes positives Echo in der gesamten deutschen Musikwelt. Im Februar 1869 schließlich folgte die Uraufführung des dann in der endgültigen Fassung siebensätzigen Werkes in Leipzig. Brahms war zu dieser Zeit erst 36 Jahre alt, und er hatte über ein Jahrzehnt am Requiem gearbeitet.
Über seine Motivation für dieses Werk wurde und wird viel spekuliert. Sicher ist, dass Brahms ein sehr ernsthafter Charakter war. „Innerlich lache ich nie“, sagte er einmal über sich selbst, und auch „Das Leben raubt einem mehr als der Tod“ ist ein von ihm überlieferter Satz. Bedeutungsvoll erwies sich in seinem Lebenslauf auch die tiefe und enge Verbindung zu Clara und Robert Schumann, denen er 1853 zum ersten Mal begegnete. Brahms verehrte den um einige Jahre älteren Komponisten tief, während Schumann seinerseits höchstes Lob für den jüngeren Freund spendete und ihn den kommenden Meister nannte. Besondere Zuneigung verband Brahms auch mit Clara Schumann. Es war ein furchtbares Ereignis für Brahms, als Robert Schumann sich 1854 zur Karnevalszeit in den eiskalten Rhein stürzte, um sich zu töten. Er wurde zwar gerettet, verbrachte danach aber die letzten beiden Jahre seines Lebens in einer Nervenheilanstalt. Die Krankheit und der Tod des geschätzten Freundes erschütterten Brahms zutiefst.
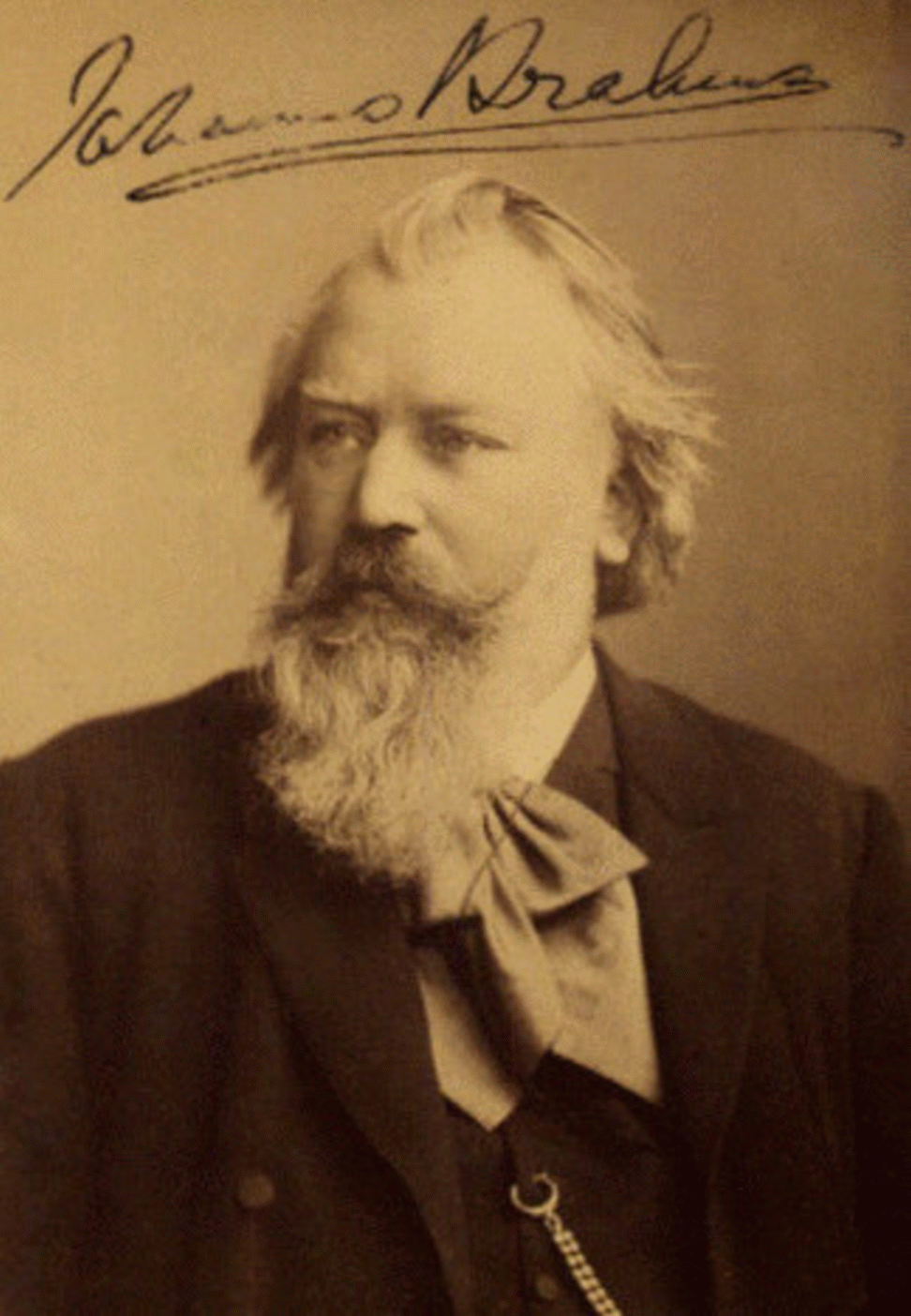
Als zweites einschneidendes Ereignis wird der Tod von Brahms Mutter im Jahre 1865 genannt. Brahms war darüber untröstlich, aber zum Zeitpunkt ihres Todes war die Arbeit am Requiem schon weit fortgeschritten. Musikhistoriker verweisen darauf, dass der nachträglich eingefügte fünfte Satz des Requiems unmittelbar mit dem Tod der Mutter in Verbindung stand: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.
Ein Requiem (Totenmesse) entstammt im eigentlichen Sinne der römisch-katholischen Liturgie. Dabei wird, wie beispielsweise bei Mozart, ein traditioneller Text verwendet, der seit dem Mittelalter bis in die heutige Zeit annähernd unverändert besteht. Ein Requiem ist ursprünglich eine lang anhaltende Fürbitte für den Verstorbenen. Die Gemeinde bittet Gott, dass er den Verstorbenen von allen Höllenqualen erlöse, dass er ihm im Jüngsten Gericht gnädig sei und ihm ewige Ruhe und Frieden schenke.
Brahms brach radikal mit dieser Tradition. Er stellte selbst eine Anordnung von Bibelzitaten zusammen, wobei er sich völlig frei quer durch den gesamten Text der Bibel bewegte. Es ist überliefert, dass er dabei bewusst die üblichen christlichen Dogmen ausließ – zum Beispiel in einem Briefwechsel mit Karl Reinthaler, dem Dirigenten der Bremer Uraufführung. Dieser meldete nach der Durchsicht der Partitur gegen die Aufführung am Karfreitag Bedenken an: „Sie stehen in diesem Werk nicht allein auf religiösem, sondern ganz auf christlichem Boden. Schon die zweite Nummer berührt die Weissagung von der Wiederkunft des Herrn … Es fehlt aber für das christliche Bewusstsein der Punkt, um den sich alles dreht, nämlich der Erlösungstod des Herrn … Sie zeigen sich durch Zusammenstellung des Textes so sehr als einen Bibelkundigen, dass Sie gewiss die richtigen Worte finden werden, falls Sie irgend noch eine Veränderung für zweckmäßig halten sollten. …“ Brahms antwortete ganz ungerührt: „Was den Text betrifft, so will ich bekennen, dass ich recht gern auch das ‘Deutsch’ fortließe und einfach den ‘Menschen’ setzte, auch mit allem Wissen und Willen Stellen wie z.B. Evang. Joh. Kap. 3 Vers 16 entbehrte. Hinwieder habe ich nun wohl manches genommen, weil ich Musiker bin, weil ich es gebrauchte, weil ich meinen ehrwürdigen Dichtern auch ein ‘von nun an’ nicht abdisputieren oder streichen kann.“
Brahms Zielsetzung war also nicht, ein christliches oder gar ein kirchliches Werk zu schaffen, sondern ein allgemein den Menschen betreffendes. Er war, bei aller Bibelkenntnis, in Bezug auf die Religion ein Skeptiker und Freigeist. Mit der Kirche konnte er herzlich wenig anfangen. Als er darauf hin einmal angegriffen wurde, entgegnete er: „Aber ich habe doch auch meinen Glauben.“
Brahms definierte das Requiem neu. Er komponierte keine Totenmesse, sondern weist den Weg des Menschen auf. Er spricht nicht vom Erlösertod, sondern von Gott – ob er damit einen persönlichen, anthropomorphen Gott meint, sei dahingestellt. Im Kontext mit den alten Weisheitslehren gelesen kann Gott, gerade wie in der Bhagavad-Gita die Person Krishnas, zum einen als die Schöpfergottheit angesehen werden, aber er kann auch als der Gott in uns, als unser eigenes höheres Selbst betrachtet werden. Die Zitate aus der Bibel belegen diese universale Sichtweise – insbesondere für die Menschen unseres westlich-christlichen Kulturkreises. Sein ‘menschliches’ Requiem ist eine Auseinandersetzung mit den kosmischen Kreisläufen von Leben und Tod, mit der Vergänglichkeit des äußeren Lebens und der Ewigkeit der Wahrheit und der inneren Welten. Er möchte den Menschen nicht Furcht vor Sünde, Gnade und dem Endgericht vermitteln wie die leidlich missbrauchten Dogmen der Kirche. Er vermittelt die Botschaft der Liebe, der Unsterblichkeit und Geborgenheit des ursprünglichen, des Urchristentums. So beginnt er sein Werk mit Worten des Trostes: „Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden.“ Im zweiten Satz nähert er sich der Endlichkeit des Körperhaften oder Äußeren mit den Worten „Denn alles Fleisch, es ist wie Gras…“. Gleichzeitig wird jedoch auch die Zyklizität des Lebens angedeutet, denn alles Gras und alle Blumen kehren im Frühjahr unweigerlich zurück und bringen neue Blüten hervor. Er weist uns mit dem schönen Jakobus Zitat darauf hin, dass alles seine Zeit hat und dass wir geduldig lernen sollen, dass sich unser Schicksal erfüllt, wenn die Zeit reif ist.
Diese Worte werden im dritten Satz noch vertieft. Nichts ist täuschender als die Illusion, dass wir uns in Sicherheit wiegen und den Tod wegdrängen. Nur wenn wir den Gedanken an den eigenen Tod zulassen, wird es uns gelingen, ein bewusstes und zielgerichtetes Leben zu führen, ein Leben in Gott, ein Leben im Sinne unserer eigenen inneren Göttlichkeit. Der einzige Trost liegt im Herrn, wobei hier nicht auf Jesus Christus verwiesen wird, sondern auf Gott allgemein oder besser auf den Gott im Inneren, das Licht in unserem Herzen. Wenn wir nicht von einem persönlichen Gott ausgehen, ist dies eine sehr universale Vorstellung.
Die Psalmen-Verse im dritten Satz beklagen auch noch die Menschen, die sich allzu sehr mit äußeren Dingen beschäftigen und darüber ihre innere Quelle vergessen (… sie sammeln und wissen nicht, wer es kriegen wird). Unseren gesamten materiellen Besitz werden wir beim Tod zurücklassen müssen, all die vermeintliche Sicherheit wird uns nicht schützen. Wir können uns im Tod nur selbst mitnehmen, das, was wir sind, das, zu dem wir uns gemacht haben.
Die Wohnungen des Herrn im vierten Satz sind wir letztendlich selbst, unser Innerstes, das Herz unseres Herzens. Gott wohnt in uns allen, und wir wohnen in Gott. „Wohl denen, die in Deinem Hause wohnen, die loben Dich immerdar“. Unsere Seelen verlangen nach den Vorhöfen des Herrn, nach den spirituellen Reichen in unserer Brust.
Der später hinzugefügte fünfte Satz spendet Trost – und zwar, indem er uns unsere eigene Unsterblichkeit vor Augen hält. Ist nicht die Verheißung von Johannes „… aber ich will euch wiedersehen …“ ein deutlicher Hinweis auf die Reinkarnation?
Das vertieft dann noch der sechste Satz: „Denn wir haben hie keine bleibende Statt, sondern die zukünfige suchen wir.“ Der Tod ist lediglich ein Tor in eine andere Ebene der Existenz. Wir ruhen in den kosmischen Kreisläufen der Evolution, wir werden lediglich immer wieder verwandelt. Diese Vorstellung nimmt dem Tod den Schrecken und die Hölle ist ohne Chance auf den Sieg, auf die ewige Verdammnis der Seele, die immer wieder heraufbeschworen wird. Alles, was geschieht, ist letztendlich Gottes Wille, oder mit theosophischen Worten gesagt, es geschieht im Rahmen eherner Gesetze, welche die Abläufe des Lebens und Sterbens steuern. Wir können diesen Gesetzen nicht entrinnen, wir sind ein Teil von ihnen. Die zukünftige Statt ist in diesem Verständnis aber nicht das angeblich ewig währende Paradies, sondern unsere Bestimmung. Und diese Bestimmung ist nicht eine Frage unseres physischen Körpers oder eines einzigen Erdenlebens. Nein, wir sind die Kinder des Universums und wir werden unser Erbe eines fernen Tages antreten.
Der abschließende siebte Satz schließt den Kreis, er verweist wie der erste Satz auf das karmische Gesetz, ohne welches die Reinkarnation nicht vorstellbar ist: „… denn ihre Werke folgen ihnen nach“.
‘Ein deutsches Requiem’ ist eines der wenigen klassischen Werke, das spirituelle Themen um den Tod, die Kreisläufe des Kosmos, Karma und Reinkarnation berührt und dabei doch auf der christlichen Bibel beruht, ohne jedoch die klassischen kirchlichen Dogmen in den Vordergrund zu rücken. Es soll hier nicht versucht werden, Brahms als einen Theosophen zu vereinnahmen – aber seine Komposition des Requiems ist von einer sehr feinen spirituellen Schwingung durchdrungen, die dem unabhängigen Wahrheitssucher ein erhellendes Licht auf dem Weg sein kann, denn er wird verwandte Gedanken erkennen. Die meisten der im Requiem verwendeten Bibelzitate sind von universaler Natur und können auch mit theosophischen Vorzeichen gedeutet werden, um ihren inneren Charakter zu verstehen.
Was hier leider überhaupt nicht beschrieben werden kann, ist die wundervolle und erhebende Musik, die Brahms als Medium für seine Botschaft komponierte, die aber in der Art und Weise, wie sie uns berührt, selbst eine Botschaft ist. Wer tiefer eindringen möchte in die Gedankenwelt des Freidenkers Brahms, dem sei wärmstens empfohlen, sich eine gute Aufnahme dieses Stückes zu besorgen und den Text beim Anhören mitzulesen. Er ist hier mit den entsprechenden Quellenangaben für weitere Studien abgedruckt.
‘Ein deutsches Requiem’ nach Worten der Heiligen Schrift
I. Chor
Selig sind, die da Leid tragen,
denn sie sollen getröstet werden.
– Matthäus 5,4
Die mit Tränen säen,
werden mit Freuden ernten.
Sie gehen hin und weinen
und tragen edlen Samen,
und kommen mit Freuden
‚und bringen ihre Garben.
– Psalm 126, 5+6
II. Chor
Denn alles Fleisch es ist wie Gras
und alle Herrlichkeit des Menschen
wie des Grases Blumen.
Das Gras ist verdorret
und die Blumen sind abgefallen.
– 1. Petrus 1,24
So seid nun geduldig, liebe Brüder,
bis auf die Zukunft des Herrn.
Siehe, ein Ackermann wartet
auf die köstliche Frucht der Erde
und ist geduldig darüber,
bis er empfahe den Morgenregen und Abendregen.
So seid geduldig.
– Jakobus 5,
Denn alles Fleisch, es ist wie Gras
und alle Herrlichkeit des Menschen
wie des Grases Blumen.
Das Gras ist verdorret
und die Blumen abgefallen.
Aber des Herrn Wort bleibet in Ewigkeit.
– 1. Petrus 1,24+25
Die Erlöseten des Herrn werden wiederkommen,
und gen Zion kommen mit Jauchzen;
Freude, ewige Freude wird über ihrem Haupte sein;
Freude und Wonne werden sie ergreifen,
und Schmerz und Seufzen wird weg müssen.
– Jesaja 35,10
III. Chor mit Bariton Solo
Herr, lehre doch mich,
dass ein Ende mit mir haben muss,
und mein Leben ein Ziel hat, und ich davon muss.
Siehe, meine Tage sind einer Hand breit vor Dir,
und mein Leben ist wie nichts vor Dir.
Ach, wie gar nichts sind alle Menschen,
die doch so sicher leben.
Sie gehen daher wie Schemen,
und machen ihnen viel vergebliche Unruhe;
sie sammeln und wissen nicht,
wer es kriegen wird.
Nun Herr, wes soll ich mich trösten?
Ich hoffe auf Dich.
– Psalm 39, 5-8
Der Gerechten Seelen sind in Gottes Hand,
und keine Qual rühret sie an.
– Weisheit Salomos 3,1
IV. Chor
Wie lieblich sind Deine Wohnungen,
Herr Zebaoth!
Meine Seele verlanget und sehnet sich
nach den Vorhöfen des Herrn;
mein Leib und Seele freuen sich
in dem lebendigen Gott.
Wohl denen, die in Deinem Hause wohnen,
die loben Dich immerdar.
– Psalm 84, 2, 3+5
V. Chor mit Sopran Solo
Ihr habt nun Traurigkeit;
aber ich will euch wiedersehen,
und euer Herz soll sich freuen,
und eure Freude soll niemand von euch nehmen.
– Johannes 16,22
Ich will euch trösten,
wie einen seine Mutter tröstet.
– Jesaja 66,13
Sehet mich an: Ich habe eine kleine Zeit
Mühe und Arbeit gehabt und habe
großen Trost funden.
– Jesus Sirach 51,35
VI. Chor mit Bariton Solo
Denn wir haben hie keine bleibende Statt,
sondern die zukünftige suchen wir.
– Hebräer 13,14
Siehe, ich sage euch ein Geheimnis:
Wir werden nicht alle entschlafen,
wir werden aber alle verwandelt werden;
und dasselbige plötzlich in einem Augenblick
zu der Zeit der letzten Posaune.
Denn es wird die Posaune schallen, und die Toten werden
auferstehen unverweslich;
und wir werden verwandelt werden.
Dann wir erfüllet werden das Wort,
das geschrieben steht:
Der Tod ist verschlungen in den Sieg.
Tod, wo ist dein Stachel!
Hölle, wo ist dein Sieg!
– 1. Korinther 15,51+52, 54+55
Herr, Du bist würdig
zu nehmen Preis und Ehre und Kraft,
denn Du hast alle Dinge erschaffen,
und durch Deinen Willen haben sie das
Wesen und sind geschaffen.
– Offenbarung Johannes 4,11
VII. Chor
Selig sind die Toten
die in dem Herren sterben,
von nun an.
Ja, der Geist spricht,
dass sie ruhen von ihrer Arbeit,
denn ihre Werke folgen ihnen nach.
– Offenbarung Johannes 14,13